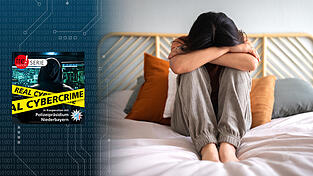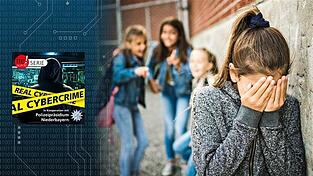Serie „Real Cybercrime“
Was in Videospielen passiert, kann auch Folgen im echten Leben haben

Anmerkung der Redaktion:
Erhöhen Shooter-Games bei Jugendlichen die Gewaltbereitschaft? Diese Frage wird seit vielen Jahren intensiv diskutiert. Langzeitstudien, die das Sozialverhalten von Kindern beim Aufwachsen mit Videospielen untersucht haben, konnten keinen Zusammenhang herstellen. Die Polizei beobachtet derweil mehr Fälle von Gewalttaten, die sich auf Videospiele beziehen. Wie diesen hier.
Ein Vormittag an einer Grundschule: Ein neunjähriger Bub reißt in der Pause einen gleichaltrigen Mitschüler hinterrücks zu Boden. Er tritt ihn mehrfach in den Bauch und schreit: „Boom! Headshot! Du bist raus!“
Die Schulleitung meldet den Übergriff unter Drittklässlern und bittet die Polizei um Hilfe. Als die Beamten eintreffen, zeigt sich der junge Täter unbeeindruckt. Im Beisein seiner Eltern erklärt er: „Wir haben Fortnite gespielt. Ich war der Letzte, der überlebt.“ Er lächelt, als sei es auch in Wirklichkeit ein Spiel. Der andere Bub jedoch trägt reale Verletzungen davon und kommt ins Krankenhaus. Diagnose: Prellungen und eine leichte Gehirnerschütterung.
Fälle wie dieser sind der Polizei nicht unbekannt. Monate zuvor hatten Lehrer berichtet, dass sich Schüler „Sniper-Ziele“ zusteckten oder andere „eliminieren“ wollten. Einige Schüler hatten begonnen, Rundenverläufe aus Fortnite oder Warzone nachzustellen: „Drop-Zonen“ wurden markiert, Teams gebildet, „Kämpfe“ gespielt – auch mit Schubsen, Treten oder verbaler Gewalt.
Was nach Ausrutschern klingt, ist für die Polizei beunruhigende Realität: Immer häufiger verlagern Kinder und Jugendliche ihre digitalen Spielinhalte ohne Nachzudenken ins echte Leben. „Gerade Kinder können oft nicht mehr zwischen virtuellen Mechanismen und realem Handeln trennen. Was im Spiel mit Punkten belohnt wird, versuchen sie auf dem Pausenhof nachzustellen“, erklärt Polizeihauptmeister Robert Zwickenpflug.
Spiele wie Fortnite, Call of Duty oder GTA Online verknüpfen Gewalt mit Belohnung. Für das Ausschalten eines Gegners erhalten Kinder Punkte, Lob, Anerkennung, digitale Währung oder einen Aufstieg auf einen neuen Rang. Diese digitale Dopamin-Belohnung ist psychologisch wirksam: Das kindliche Gehirn merkt sich die positive Verstärkung – Aggressivität wird so als sozialer Erfolg abgespeichert. Polizeihauptmeister Robert Zwickenpflug meint dazu: „Wir sehen regelmäßig Jugendliche, die wegen massiver Gewalt auffallen – viele davon sind bereits seit Jahren in solchen Spielwelten unterwegs.“
Was passiert bei solchen Vorfällen?
Im geschilderten Fall ist der Täter neun Jahre alt und damit nicht strafmündig. Das bedeutet jedoch nicht Straflosigkeit. Vielmehr erfolgt eine Meldung an das Jugendamt, das dann erzieherische Maßnahmen prüfen und einleiten kann. Und trotz der Strafunmündigkeit erstellt die Polizei einen Bericht, dokumentiert die Tat, nimmt das Umfeld auf und übergibt alle relevanten Informationen an Schule und Jugendhilfe. Ab dem 14. Geburtstag gelten Jugendliche als strafmündig. Wer dann jemandem körperlichen Schaden zufügt, muss mit Ermittlungen wegen Körperverletzung oder gefährlicher Körperverletzung rechnen – je nach Ausmaß. Auch schulrechtlich greifen Maßnahmen, zum Beispiel ein Ausschluss vom Unterricht, Verweise oder Nachsitzen.
Gewalt wächst mit – die Folgen:
In den vergangenen Jahren häufen sich Fälle, in denen Jugendliche mit 14, 15 oder 16 Jahren durch Gewalttaten auffallen. Oft gibt es eine Vorgeschichte:
- frühe Nutzung von nicht altersgerechten Spielen
- keine oder geringe Kontrolle der Eltern
- zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid anderer
Viele Schulen melden zunehmend der Polizei, dass digitale Spielmechaniken in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen fester Bestandteil ihrer Kommunikation und Konfliktbewältigung sind. Aussagen wie „Headshot! Du bist raus!“ tauchen laut den Schilderungen immer wieder auf dem Pausenhof und in Klassenchats auf.
Diese Zitate oder körperliche Auseinandersetzung sind dann der Grund, weshalb bereits Familien mit Grundschulkindern bei der Polizei für erzieherische Gespräche vorgeladen werden. Ein Unrechtsbewusstsein ist dabei oft nicht erkennbar. Gewalt wird als normales Mittel zur Konfliktlösung angesehen.

Florian Wende, dmutrojarmolinua/Chor muang – stock.adobe.com
Polizeihauptmeister Robert Zwickenpflug.
Polizeihauptmeister Robert Zwickenpflug rät
Für die Familie:
- Die Altersfreigaben (USK) bei Spielen ernst nehmen – sie sind keine einfachen Empfehlungen, sondern Schutzgrenzen.
- Mit dem Betroffenen mitspielen oder sich erklären lassen, was im Spiel passiert.
- Auf Sprache, Verhalten, Körpersprache nach dem Spielen achten – oft lassen sich so erste Warnzeichen erkennen.
- Über Gewalt reden: Was ist echt? Was ist Spiel? Was tut weh? Kinder müssen früh lernen, was real ist – und was nicht.
Für die Gesellschaft:
- Digitale Gewalt muss ernst genommen werden.
- Wer Kinder mit problematischen Inhalten allein lässt, der trägt Mitverantwortung.
- Der Alltag auf digitalen Plattformen ist heute ebenso prägend wie Familie oder Schule