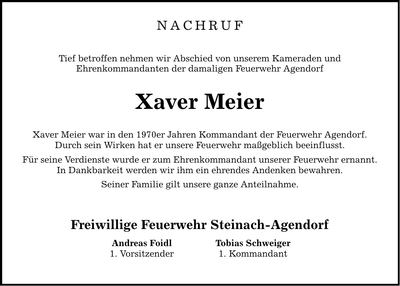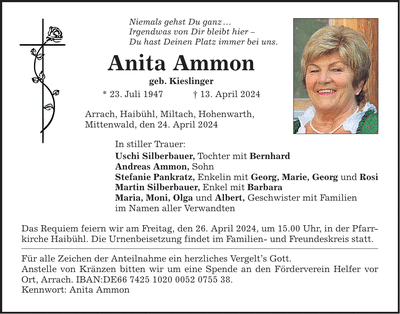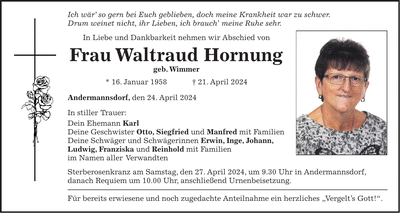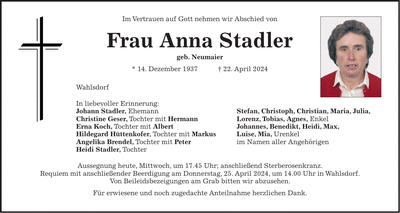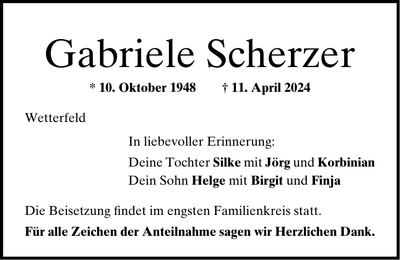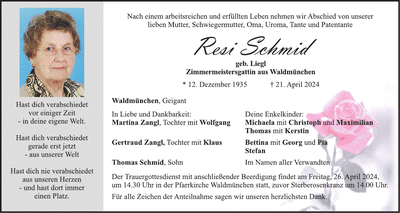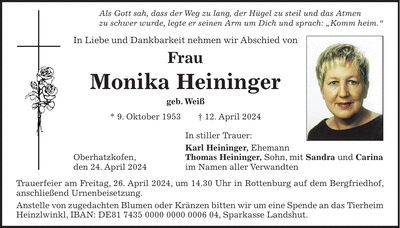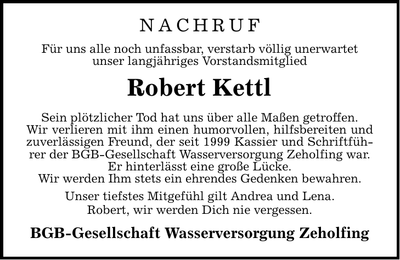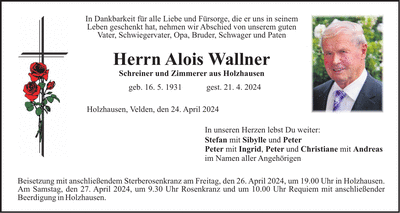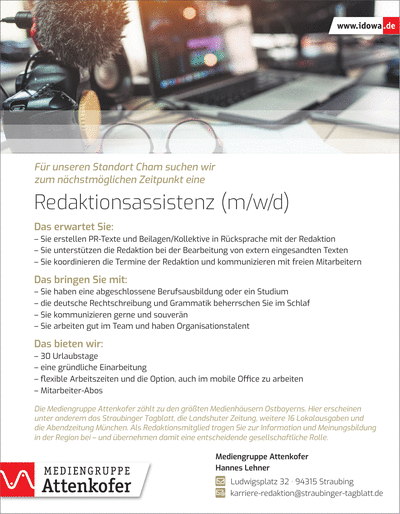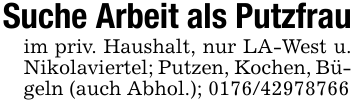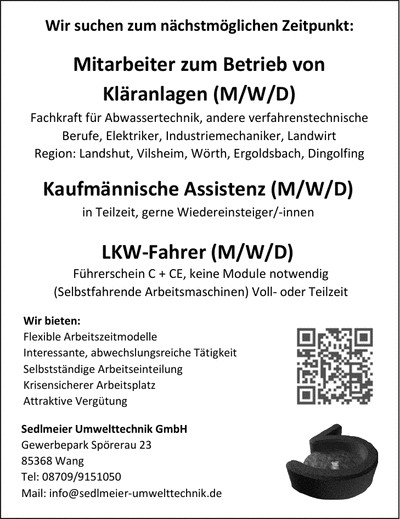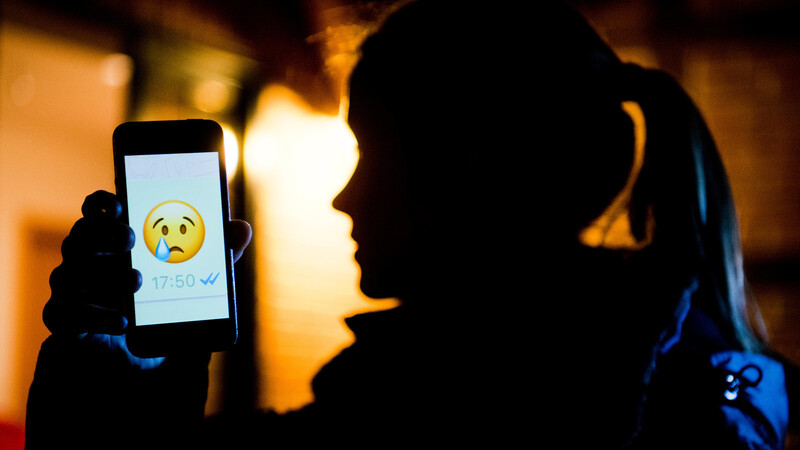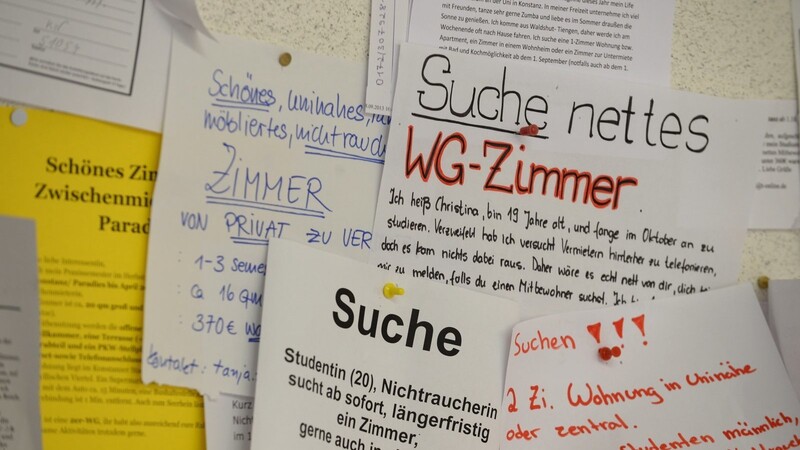Amtsgericht Landau
Freispruch wegen zu vieler Widersprüche und Ungereimtheiten
70-Jähriger verstorben
B8-Sperre nach schwerem Unfall bei Aholming aufgehoben
Abfahrtast verpasst
Suzuki reißt in Cham Tank auf, 240 Liter Diesel laufen aus
Meistgelesen
Sport

Vierfache Weltmeisterin
Die Erfolgsgeschichte von Eisschwimmerin Christina Gockeln
Aus (NHL-)Erfahrung gut
Justin Braun hängt noch eine Saison bei den Straubing Tigers dran
Diese Plus-Geschichten sollten Sie lesen
149 Appartements
Neue Altenwohnanlage für Senioren in Straubing geplant
FSME in Landshut
"Der Mensch ist für Zecken eigentlich der Falsche"
Das Neueste im Ticker
7 Stunden
Further Singer-Songwriter mit neuem Werk
Bayern
Kommentare der Redaktion
Leben

Zwei Jahre um die Erde
Rückblick auf Asien und Ozeanien: Kati Auerswald berichtet von ihrer Weltreise
2
Rezept
So kocht die Region
Bruckbaam auf Speckkraut mit Apfelmost
Blaulicht

Schwer verletzt
Rennradfahrerin prallt in Sallach in Beifahrerseite von Auto
Freistunde
Mehr aus Niederbayern und der Oberpfalz


Wohnbauprojekt statt Autohaus
30 Wohneinheiten in Regensburg: Gestaltungsbeirat dreht an Stellschrauben