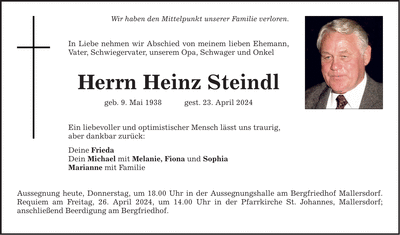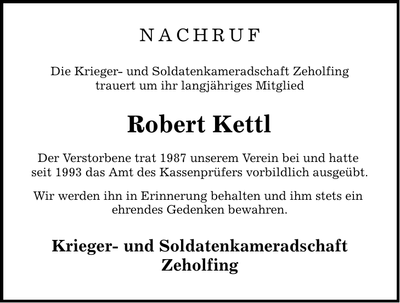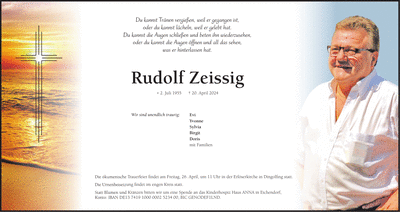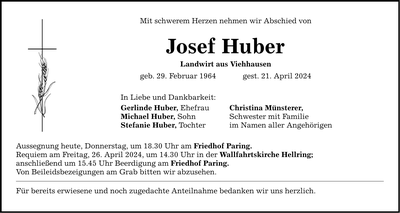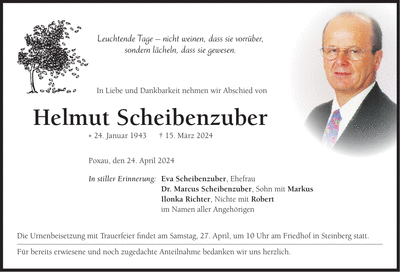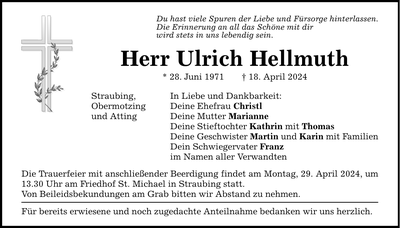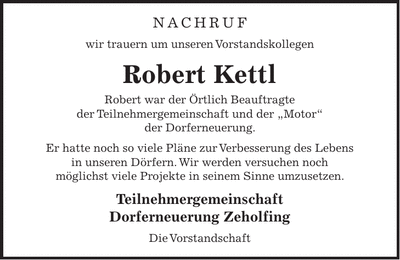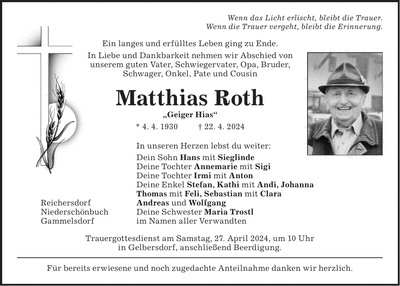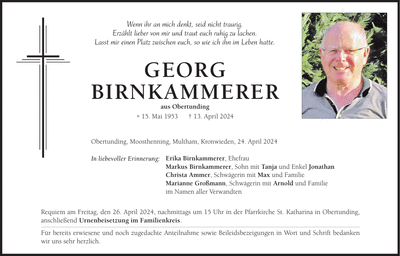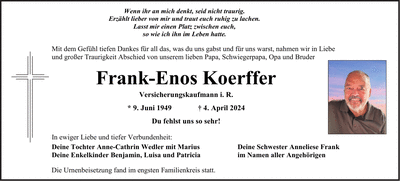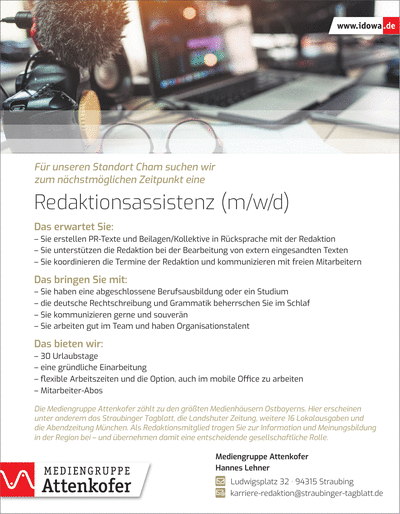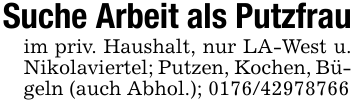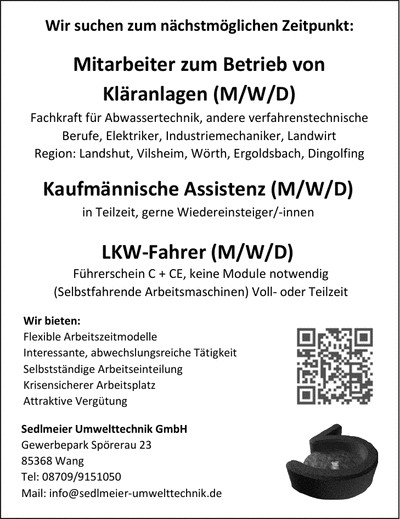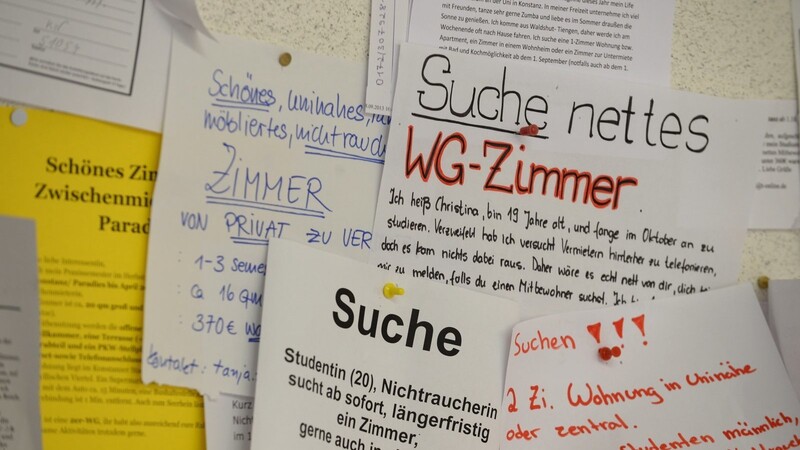149 Appartements
Neue Altenwohnanlage für Senioren in Straubing geplant
Meistgelesen
Sport

Vierfache Weltmeisterin
Die Erfolgsgeschichte von Eisschwimmerin Christina Gockeln
Aus (NHL-)Erfahrung gut
Justin Braun hängt noch eine Saison bei den Straubing Tigers dran
Diese Plus-Geschichten sollten Sie lesen
FSME in Landshut
"Der Mensch ist für Zecken eigentlich der Falsche"
Wohnbauprojekt statt Autohaus
30 Wohneinheiten in Regensburg: Gestaltungsbeirat dreht an Stellschrauben
Konrad-Adenauer-Straße
Die Brückenbaustelle in Landshut rückt näher
Das Neueste im Ticker
13 Stunden
Further Singer-Songwriter mit neuem Werk
Kommentare der Redaktion
Leben

Zwei Jahre um die Erde
Rückblick auf Asien und Ozeanien: Kati Auerswald berichtet von ihrer Weltreise
2
Rezept
So kocht die Region
Bruckbaam auf Speckkraut mit Apfelmost
Blaulicht

Tödlicher Ausgang
Frau stirbt bei Verkehrsunfall im Landkreis Erding
Update
70-Jähriger verstorben
B8-Sperre nach schwerem Unfall bei Aholming aufgehoben
Freistunde
Mehr aus Niederbayern und der Oberpfalz