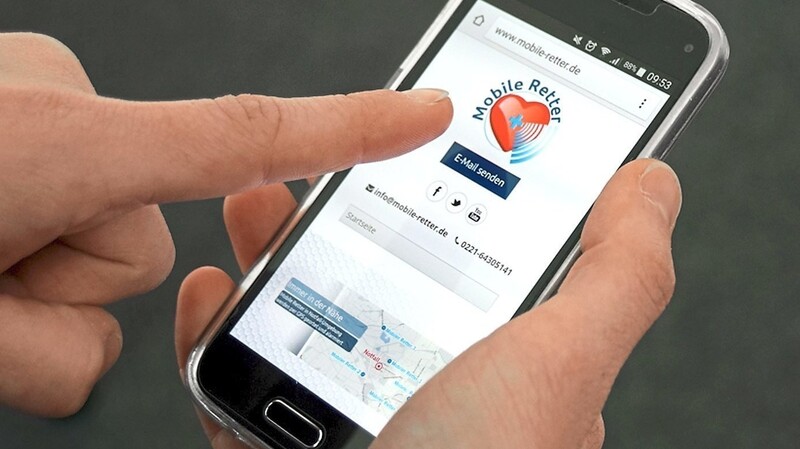Straubing
Zwischen Leben, Tod und Hosentaschen
28. Februar 2017, 11:39 Uhr aktualisiert am 28. Februar 2017, 11:39 Uhr

Regina Hölzel
Von links nach rechts: Christian Sievert, Michael Zitzl, Daniel Kettl, Siegfried Scholz - Am Tisch: Franz Wagner
In der Leitstelle arbeiten rund um die Uhr Disponenten und koordinieren die Einsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst - wenn sie sich nicht gerade mit allerhand Unfug herumärgern müssen.
Christian Sievert durchlebt einen Schreckmoment. Bei einem Anruf ist nur schweres Atmen zu hören. Als ihm auf seine Fragen niemand antwortet, wird er lauter. Er fragt mehrmals nach, was los ist, bekommt aber keine Antwort. Mit einem Klick erscheint die Adresse des Anrufers auf seinem Monitor. Als er ein letztes Mal laut nachfragt, ob sein Gegenüber sich irgendwie verständigen kann, meldet sich eine Stimme: "Oh, Entschuldigung, ich habe gar nicht gemerkt, dass das Telefon an ist." Christian atmet auf. Es war nur ein Hosentaschenanruf.
Das Team der Leitstelle Straubing ist für die Landkreise Straubing-Bogen, Deggendorf und Regen verantwortlich. Notrufe an die 112 landen hier. Jeder Anruf muss beantwortet werden. Hinter jedem Klingeln könnte ein Notfall lauern. Oder eine Hosentasche. "Etwa dreißig sogenannter Hosentaschenanrufe kommen täglich", Schätzt Daniel Kettl grob. "Die Leute haben ihr Telefon eingesteckt und wählen aus Versehen die Notrufnummer." Meist hört der Disponent dann leise Stimmen, aber es antwortet niemand.
Der Weg ins Innere der Zentrale führt durch einen langen Gang und eine Reihe von Sicherheitsschleusen, die sich nur mit einer Chipkarte öffnen lassen. Hinter der letzten Tür öffnet sich ein großer Raum mit sechs langen Tischen. Er wird frühmorgens nur von den sechs Bildschirmen beleuchtet, die an jedem Arbeitsplatz stehen. Noch ist es still, nur hin und wieder klingelt es oder eine blecherne Stimme meldet sich über Funk.
In der Grippesaison
Zu Anfang ihrer zwölfstündigen Schicht scherzen die Männer, reden über ihre Kinder. Doch nach einem kurzen Gespräch mit den Nachtschichtlern verfinstert sich Daniels Gesichtsausdruck. Er ist heute Schichtführer und hat einen harten Tag vor sich. Es haben sich sehr viele Krankenhäuser abgemeldet. Sie haben keinen Platz für neue Patienten. Er studiert einen der sechs Bildschirme vor sich. Die jugendlichen Züge verschwinden von seinem Gesicht, als sich eine Falte zwischen seinen Augenbrauen bildet. Es stehen viele Krankentransporte an. Er seufzt: "Könnte ein Problem werden."
Viele Anrufe sind ein Fall für den ärztlichen Notdienst und nicht für den Notruf. Christian telefoniert gerade zum zweiten Mal mit demselben Anrufer. Er knirscht mit den Zähnen, als er den Knopf zum Auflegen drückt. Sein Urteil: "Der hat 'ne Grippe, da kann ich doch keinen Notarzt schicken." Die Ressourcen sind knapp. Auf dem Bildschirm mit der Fahrzeugübersicht leuchten nur ein paar Felder. Das sind die verfügbaren Wägen. Wegen des Nebels bleiben auch die meisten Hubschraubersymbole grau. Sie können nicht abheben. Viele der Krankentransporte sollen Patienten mit ansteckenden Krankheiten fahren. Daniel sieht sich die Liste mit den gebuchten Fahrten nochmal an und deutet auf das Wort "infektiös" in einer der oberen Zeilen: "Wenn ich da einen Wagen hinschicke, dann muss der gereinigt werden. Damit fällt er lange aus."
Hinter dem Zeitplan
Schon gegen Mittag färbt sich ein Großteil der Liste hellblau. Die hellblauen Einsätze verspäten sich. Es sind einfach nicht genug Autos da. Immer wieder rutscht ein Krankentransport nach hinten, weil Notfälle Vorrang haben. Christian dreht sich zu Daniel und seufzt: "Gerade hat jemand versucht, mir einen Notfall vorzuschwindeln, weil die Wartezeiten so lang sind. Manche Leute haben das Gefühl, dass wir nur für sie da sind."
Wenn nichts läutet oder piepst, reden die Männer über alltägliche Dinge wie das Mittagessen oder wer mehr Punkte in Flensburg hat. Sie albern herum und lachen. "Humor ist ganz wichtig, das hilft gegen den Stress", sagt Andreas Fischer. Er hat die erste Hälfte der Schicht als Funker für den Rettungsdienst gearbeitet; an der stressigsten Position hier. Sein Mauszeiger huscht zwischen Fahrzeugübersicht, Fahrtenliste und Landkarte umher. Er verteilt die Einsätze an die Kranken- und Rettungswägen.
Zwei Minuten
Auf einmal hauen Daniel und Franz in die Tasten und sprechen hastig in ihre Mikrophone. Ein Kleinkind braucht dringend Hilfe. Weder Rettungswagen noch ein Notarzt sind in der Nähe. Nach ein paar Telefonaten atmet Daniel auf: Die Rettungskräfte sind auf dem Weg. Es hat keine zwei Minuten gedauert, jemanden aufzutreiben, der den Einsatz annimmt. Im schlimmsten Fall entscheiden zwei Minuten über Leben und Tod.
Christian redet oft mit den anderen über die Anrufe. "Wir dürfen sonst mit keinem über die Arbeit reden. Wir sind ja an die Schweigepflicht gebunden", meint er. "Als Einzelkämpfer kann man das nicht schaffen", fügt Andreas hinzu und lächelt in die Runde.
Da geben ihm alle recht. Die Mannschaft funktioniert wie ein Uhrwerk. Sobald mehrere Notrufe gleichzeitig am Display aufblinken, kleben alle an ihren Monitoren und rufen sich kurz und knapp die wichtigsten Informationen zu. Wenn es ruhiger wird, lehnen sie sich zurück und die Sätze werden länger.
Ein stressiger Job
"Man hat ständig eine gewisse Grundanspannung und die kann man nicht loswerden." Franz Wagner fährt selbst noch Schichten auf einem Rettungswagen. "Wenn man draußen ist, als Sanitäter, dann kann man das Adrenalin wieder abbauen."
Am meisten haben die Männer an den Beleidigungen von Anrufern zu knabbern. "Manche Leute werden am Telefon aggressiv", macht sich Christian Luft. "Man muss sich immer vor Augen halten, dass die Leute unter Stress stehen." Er nippt an seinem Kaffee und setzt ein Lächeln auf. "Man muss freundlich bleiben und wissen, wie man mit den Menschen umgeht. Das fällt nicht immer leicht."
An einem der hinteren Tische erklärt Michael Zitzl einem Anrufer den Unterschied zwischen Schlüssel- und Rettungsdienst. Seine Stimme klingt gelassen, er rollt die Augen. Siggi Scholz lehnt sich in seinem Bürostuhl zurück. Er geht in wenigen Wochen in Rente. 38 Jahre hat er in der Leitstelle gearbeitet. Ob er sich nochmal für die Arbeit entscheiden würde, weiß er nicht. Die Zeiten sind hektischer geworden. Mit der Technik kommt er nicht mehr gut klar. "Früher hatten wir ein Telefon, ein Funkgerät und einen Haufen Zettel. Heute muss alles dokumentiert werden. Das Computerprogramm speichert so viele Informationen, da ist es wirklich anstrengend, den Überblick zu behalten." Er wirft einen genervten Seitenblick auf den Monitor mit der Fahrtenliste.
Gegen Ende der Zwölfstundenschicht grinst Daniel halbherzig: "Der Nachtdienst wird alle Fahrten, die noch ausstehen, recht flott abwickeln können." In diesem Moment tauchen noch ein paar Notfälle in der Liste auf. Sofort macht er sich an die Arbeit. Er unterdrückt ein Gähnen.